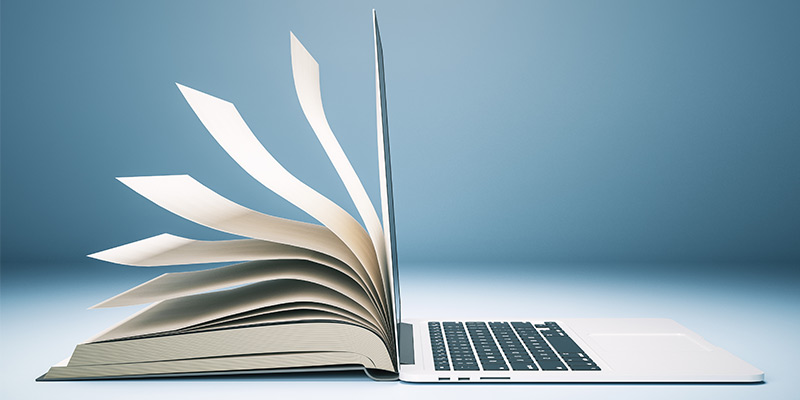- Immobilienwissen | Lexikon.
Hier erhalten Sie eine umfassende Übersicht über relevante Themen der Immobilienwertermittlung.
Erfahren Sie alles Wissenswerte rund um Bewertungskriterien, Marktanalysen und rechtliche Rahmenbedingungen.
Immobilienwissen | Allgemeines.
Der Marktwert und der Verkehrswert können als Synonym verwendet werden. Grundsätzlich ist damit gemeint, zu welchem Preis eine Immobilie im offenen Markt gehandelt werden könnte. Die genaue Definition regelt der §194BauGB. Der genaue Gesetzestext lautet:
"Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre."
Der Beleihungswert ist ein Begriff aus dem Kreditwesen, insbesondere im Zusammenhang mit der Immobilienfinanzierung.
Er wird folgendermaßen definiert (§16 Abs. 2 PfandBG):
"Der Beleihungswert darf den Wert nicht überschreiten, der sich im Rahmen einer vorsichtigen Bewertung der zukünftigen Verkäuflichkeit einer Immobilie und unter Berücksichtigung der langfristigen, nachhaltigen Merkmale des Objektes, der normalen regionalen Marktgegebenheiten sowie der derzeitigen und möglichen anderweitigen Nutzungen ergibt. Spekulative Elemente dürfen dabei nicht berücksichtigt werden. Der Beleihungswert darf einen auf transparente Weise und nach einem anerkannten Bewertungsverfahren ermittelten Marktwert nicht übersteigen. Der Marktwert ist der geschätzte Betrag, für welchen ein Beleihungsobjekt am Bewertungsstichtag zwischen einem verkaufsbereiten Verkäufer und einem kaufbereiten Erwerber, nach angemessenem Vermarktungszeitraum, in einer Transaktion im gewöhnlichen Geschäftsverkehr verkauft werden könnte, wobei jede Partei mit Sachkenntnis, Umsicht und ohne Zwang handelt."
Der Beleihungswert ist also eine vorsichtige Schätzung des langfristig erzielbaren Wertes einer Immobilie, die der Bank als Grundlage für die Kreditvergabe dient. Er stellt sicher, dass die Bank im Falle einer Zwangsverwertung des Sicherungsobjekts (z.B. bei Zahlungsausfall des Kreditnehmers) keine Verluste erleidet.
Ein Gutachten zur Immobilienbewertung ist ein dokumentiertes und fundiertes Expertendokument, das den Wert einer Immobilie zu einem bestimmten Zeitpunkt ermittelt. Dieses Gutachten wird von einem qualifizierten (und ggf. zertifizierten) Sachverständigen
erstellt und dient verschiedenen Zwecken, wie zum Beispiel der Finanzierung, dem Kauf oder Verkauf, der Besteuerung, der Ermittlung von Versicherungswerten oder im Rahmen rechtlicher Auseinandersetzungen.
IIm Rahmen eines sog. Vollgutachten (im Sinne des §194 BauGB), müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:
- Festlegung des Wertermittlungsstichtags und Beschreibung des tatsächlichen Grundstückzustands und ggf. des bei der Wertermittlung davon abweichend unterstellten Zustands.
- Wahl des oder der anzuwendenden Wertermittlungsverfahren und Begründung der Wahl.
- Berechnung der Verfahrensergebnisse
- Ableitung des Marktwerts aus den Verfahrensergebnissen unter Würdigung deren Aussagefähigkeit.
- Festlegung des Wertermittlungsstichtags und Beschreibung des tatsächlichen Grundstückzustands und ggf.des bei der Wertermittlung davon abweichend unterstellten Zustands.
- Wertermittlungsstichtag: Tag der Wertermittlung
- Qualitätsstichtag: Meistens identisch mit Wertermittlungsstichtag.
In bestimmten Fällen kann dieser jedoch abweichen (z.B. Sanierung, Enteignung).
- Grundstückszustand: wertbeeinflussende Eigenschaften werden berücksichtigt. - Wahl des oder der anzuwendenden Wertermittlungsverfahren und Begründung und der Wahl.
- Berechnung der Verfahrensergebnisse
- Ableitung des Marktwerts aus den Verfahrensergebnissen unter Würdigung deren Aussagefähigkeit.
Ein Gutachten muss:
- systematisch und einheitlich aufgebaut,
- übersichtlich gegliedert,
- nachvollziehbar begründet,
- auf das Wesentliche beschränkt und
- vollständig
sein
Die Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) ist eine gesetzliche Grundlage, die die Verfahren zur Bestimmung desVerkehrswertes von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie von Rechten an Grundstücken regelt. Ziel der Verordnung ist es,durch standardisierte Bewertungsverfahren eine objektive und nachvollziehbare Bewertung sicherzustellen.
Unsere Bewertungen werden von zertifizierten und erfahrenen Sachverständigen durchgeführt, die fundierte Marktkenntnisse und Expertise in der Immobilienbewertung besitzen.
Das Baugesetzbuch (BauGB) ist das zentrale Gesetz im deutschen Städtebaurecht. Es regelt die rechtlichen Rahmenbedingungen für diestädtebauliche Entwicklung und Ordnung in Deutschland. Das BauGB legt fest, wie der Boden genutzt werden darf, um eine nachhaltigestädtebauliche Entwicklung zu fördern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu sichern.
Ein Gutachterausschuss ist ein unabhängiges Gremium, das zur Ermittlung und Überwachung von Grundstückswerten eingerichtet wird.Diese Ausschüsse gibt es auf kommunaler oder regionaler Ebene und sie führen u.a. die Kaufpreissammlungen.
Die Mikrolage bezieht sich auf die unmittelbare Umgebung einer bestimmten Immobilie. Sie beschreibt, welche Bedingungen und Merkmale direkt um die Immobilie herum vorhanden sind. Dazu gehören die unmittelbare Nachbarschaft, die Verkehrsanbindung, die Nähe zu Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, öffentlichen Einrichtungen, Grünflächen und anderen infrastrukturellen Gegebenheiten. Die Mikrolage ist daher entscheidend für die Lebensqualität und die Alltagstauglichkeit einer Immobilie, da sie direkten Einfluss auf die Bewohnbarkeit und die Nutzung hat.
Die Makrolage beschreibt die übergeordnete Lage einer Immobilie innerhalb einer Stadt oder einer Region. Sie betrachtet Faktoren auf einer größeren Skala, wie die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt oder Region, die demografische Struktur, die politische und gesellschaftliche Stabilität, die Verkehrsinfrastruktur (z.B. Autobahnen, Flughäfen, öffentlicher Nahverkehr) sowie kulturelle und soziale Angebote. Die Makrolage bestimmt maßgeblich die Wertentwicklung einer Immobilie über einen längeren Zeitraum hinweg und beeinflusst ihre Attraktivität für potenzielle Käufer oder Mieter.
Ein Energieausweis ist ein offizielles Dokument, das auf Grundlage einer energetischen Bewertung Auskunft über den Energieverbrauchund die Energieeffizienz eines Gebäudes gibt. Er wird in zwei Arten unterteilt:
Verbrauchsausweis: Der Verbrauchsausweis basiert auf den tatsächlichen Verbrauchsdaten des Gebäudes, die über einen bestimmtenZeitraum gemessen werden (z.B. Heizkostenabrechnungen der letzten Jahre).
Bedarfsausweis: Der Bedarfsausweis berücksichtigt die baulichen und technischen Merkmale des Gebäudes, wie z.B. Dämmung,Fensterqualität, Heizsystem etc., um den theoretischen Energiebedarf zu berechnen.
Der Zweck des Energieausweises ist es, Transparenz über die energetische Qualität von Gebäuden zu schaffen und Verbrauchern einefundierte Entscheidung zu ermöglichen. Er informiert darüber, wie energieeffizient ein Gebäude ist und gibt Hinweise darauf, welcheMaßnahmen zur Verbesserung der Energiebilanz ergriffen werden könnten.
Immobilienwissen I Bodenwertermittlung.
Die Ermittlung der Bodenwerte ist sowohl für die Bewertung unbebauter als auch bebauter Grundstücke erforderlich.Grundsätzlich werden Bodenwerte primär im Vergleichswertverfahren ermittelt, ohne dabei die vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Grundstück zu berücksichtigen (vgl. §§ 17 Abs. 2 und 21 Abs. 1 ImmoWertV). Alternativ können auch geeignete Bodenrichtwerte zur Bestimmung der Bodenwerte verwendet werden, entweder zusätzlich zu oder anstelle von Vergleichsgrundstücken (vgl. § 16 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV).
Für die Ermittlung der Bodenwerte müssen ausreichend viele geeignete Vergleichspreise für unbebaute Grundstückevorhanden sein. Die weiteren Anforderungen, denen diese Vergleichspreise genügen müssen, sind in der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) geregelt.
Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert für den Boden (Grundstück) eines bestimmten Gebiets.Er wird von den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte festgelegt und dient als Richtwert für die Wertermittlungvon unbebauten Grundstücken.
Eine Bodenrichtwertkarte ist eine kartografische Darstellung, auf der die Bodenrichtwerte für verschiedene Gebieteoder Teilgebiete einer Stadt oder Region eingetragen sind. Sie bietet einen visuellen Überblick über diedurchschnittlichen Bodenwerte innerhalb eines definierten geografischen Bereichs.
Bodenpreisindexreihen spiegeln die Veränderungen der allgemeinen Wertverhältnisse in Bezug auf Bodenpreise wider.Sie werden aus dem lokalen Grundstücksmarkt abgeleitet und bestehen aus Indexzahlen, die das durchschnittlicheVerhältnis der Bodenpreise eines Erhebungszeitraums zu den Bodenpreisen eines Basiszeitraums mit der Indexzahl 100darstellen.
Die GFZ (Geschossflächenzahl) gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche eines Gebäudes im Verhältnis zur Grundstücksfläche maximal bebaut werden darf.
Für die Wertermittlung ist es ratsam, eine "wertrelevante Geschossflächenzahl - WGFZ" zu berechnen. Dieseberücksichtigt zusätzlich zu den regulären Geschossflächen auch solche Bereiche, die nach den baurechtlichenVorschriften nicht vollständig angerechnet werden, jedoch einen wirtschaftlichen Nutzen haben (z.B. Hobbyräume,Verkaufsflächen im Untergeschoss-Teil).
Umrechnungskoeffizienten sind Faktoren, die verwendet werden, um Werte oder Einheiten in eine andere Größeumzurechnen. Sie dienen dazu, eine direkte Umwandlung zwischen verschiedenen Werten zu ermöglichen, um Vergleichedurchzuführen und im Kontext der Immobilienbewertung Wertunterschiede darzustellen.
Beispiele in der Immobilienwertermittlung sind:
- WGFZ-Umrechnungskoeffizienten
- GFZ-Umrechnungskoeffizienten
- Grundstücksgrößen-Umrechnungskoeffizienten
- u.v.m.
Die Lage einer Immobilie ist eines der maßgeblichsten Merkmale für deren Wert. Entsprechend wichtig ist die genaueBetrachtung der Vergleichswerte und Bodenrichtwerte zur Erfassung des passenden Bodenwerts.Umrechnungskoeffizienten und Bodenrichtwerte, anderer, vergleichbarer Gebiete können dabei helfen.
Der Entwicklungszustand des Bodens bezieht sich auf den aktuellen Stand und die potenziellen Möglichkeiten derNutzung oder Veränderung eines Grundstücks. Er umfasst Aspekte wie die aktuelle Bebauung, die Erschließung durch z.B.Infrastruktur, den Baurechtsstatus sowie gegebenenfalls bestehende Einschränkungen. Wertmäßige Faktoren, wieErschließungs- und Ausbaubeiträge müssen bei der Bodenwertermittlung erfasst und berücksichtigt werden.
Immobilienwissen I Vergleichswertverfahren.
Das Vergleichswertverfahren wird klassischerweise in der Immobilienbewertung angewandt, wenn ausreichend Vergleichsdatenfür ähnliche Immobilien vorhanden sind.Es eignet sich besonders für die Bewertung von:
- Eigentumswohnungen
- Ein- und Zweifamilienhäuser
- Grundstücken (Bodenwert)
Dabei werden die Verkaufspreise (nicht Angebotspreise) vergleichbarer Objekte herangezogen und mittels Umrechnungskoeffizientenund Indexreihen auf das Bewertungsobjekt angepasst.
Das Vergleichswertverfahren kann als Vergleichspreis- oder als Vergleichsfaktorverfahren angewandt werden.
Beim Vergleichspreisverfahren wird die Wertermittlung eines Bewertungsobjekts durch den direkten Vergleich mit tatsächlich erzieltenKaufpreisen vergleichbarer Objekte durchgeführt.
Unbebaute und bebaute Grundstücke können auch mittels Vergleichsfaktorverfahren bewertet werden. Vergleichsfaktoren sinddurchschnittliche Verhältniszahlen, die aus einer Vielzahl von Vergleichspreisen abgeleitet werden.
Immobilienwissen I Ertragswertverfahren
Das Ertragswertverfahren wird, ebenso wie die anderen in der ImmoWertV geregelten Vergleichs- und Sachwertverfahren, zur Schätzungdes Marktwerts verwendet. Üblicherweise wird das Ertragswertverfahren bei bebauten Grundstücken angewandt, die zur Erzielung von Renditen gehandelt werden(z.B. Mehrfamilienhaus, Gewerbeobjekte, u.s.w.)
Verschiedene Ertragswertverfahren
Die ImmoWertV regelt in §17 drei Varianten zur Ermittlung des Ertragswerts:
- Allgemeines Ertragswertverfahren
- Vereinfachtes Ertragswertverfahren
- Ertragswertverfahren auf der Grundlage periodisch unterschiedlicher Erträge (periodisches Ertragswertverfahren)
Das allgemeine Ertragswertverfahren berechnet den Marktwert einer Immobilie, indem es die nachhaltig erzielbaren Einnahmen abzüglich der Bewirtschaftungskosten und dem Bodenwertverzinsungsbetrag ermittelt und diesen verbleibenden Reinertrag kapitalisiert. Der Bodenwert wird separat ermittelt und zum kapitalisierten Ertragswert der baulichen Anlagen hinzugefügt, um den Gesamtwert der Immobilie zu bestimmen.
Formel:
EW = (RE - BW x LZ) x KF + BW +/- boG
EW = Ertragswert
RE = Reinertrag
BW = Bodenwert (ohne selbstständig verwertbare Teilflächen)
LZ = Liegenschaftszins
KF = Kapitalisierungsfaktor (Barwertfaktor)
boG = Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale
Im vereinfachten Ertragswertverfahren wird der Marktwert einer Immobilie als Barwert der zukünftigen Reinerträge berechnet, zuzüglich des diskontierten Bodenwerts über die Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen.
Formel:
EW = RE x KF + BW x 1/q^n +/- boG
EW = Ertragswert
RE = Reinertrag
BW = Bodenwert (ohne selbstständig verwertbare Teilfläche)
KF = Kapitalisierungsfaktor (Barwertfaktor)
1/q^n = Abzinsungsfaktor
LZ = Liegenschaftszins
n = Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen
boG = Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale
Das periodische Ertragswertverfahren wird für Immobilienbewertungen angewendet, bei denen die Erträge signifikanten Veränderungen unterliegen oder erheblich von den marktüblichen Erträgen abweichen. Hierbei werden nicht die marktüblichen, sondern die tatsächlichen Erträge der Immobilie berücksichtigt.
Der Wert ergibt sich aus den tatsächlich Reinerträgen, sowie dem Restwert des Grundstücks am Ende des Betrachtungszeitraums.
Die periodischen Reinerträge sowie der Restwert des Grundstücks sind jeweils auf den Wertermittlungsstichtag abzuzinsen.
Rohertrag
Gemäß ImmoWertV entsteht der Rohertrag aus den Einnahmen, die aus dem Grundstück durch ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung erzielt werden können, insbesondere durch Mieten und Pachten.
Reinertrag
Der Reinertrag einer Immobilie ist der Betrag, der sich ergibt, wenn vom Rohertrag (den erzielbaren Einnahmen aus Mieten und Pachten) die Bewirtschaftungskosten abgezogen werden. Er stellt den Nettoertrag dar, der nach Abzug aller Aufwendungen und Kosten für die Bewirtschaftung der Immobilie verbleibt.
Bewirtschaftungskosten sind Kosten, die der Eigentümer zu tragen hat und demnach nicht auf den Mieter umlegbar sind. Sie schmälern somit den Ertrag aus dem Grundstück. Berücksichtigungsfähige Bewirtschaftungskosten sind:
- Verwaltungskosten
- Instandhaltungskosten
- Mietausfallwagnis
- Betriebskosten, die nicht umlagefähig sind
Die Restnutzungsdauer ist die Zahl der Jahre, in denen die baulichen Anlagen "Gebäude" bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können.
In Bezug auf das Ertragswertverfahren ist der Liegenschaftszins der Marktanpassungsfaktor. Er stellt somit sicher, dass der ermittelte Ertragswert marktkonform ist.
Der Barwertfaktor ist ein Multiplikator, der verwendet wird, um zukünftige Erträge einer Immobilie auf ihren gegenwärtigen Wert zu diskontieren. In der Immobilienbewertung wird der Barwertfaktor verwendet, um die Erträge zu kapitalisieren und somit den aktuellen Wert der Immobilie zu ermitteln.
Immobilienwissen I Sachwertverfahren
Das Sachwertverfahren ist eine Bewertungsmethode zur Marktwertermittlung von Immobilien, die vor allem bei eigengenutztenImmobilien angewendet wird. Es bietet eine nachvollziehbare und strukturierte Herangehensweise, um den Wert einer Immobiliebasierend auf dem Substanzwert des Gebäudes (und sonstigen Anlagen) und des Bodenwerts zu bestimmen.
Das Sachwertverfahren basiert im Wesentlichen auf der Beurteitlung des Substanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstücks) wird als Summe aus dem Bodenwert, dem vorläufigen Sachwert der baulichen Anlagen und dem vorläufigen Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ermittelt.
Folgendes Schema ergibt sich hieraus:
Gebäudewert (Herstellungskosten ./. Alterswertminderung)
+ Wert der Außenanlagen
+ Bodenwert
= Vorläufiger Sachwertx Sachwertfaktor
= marktangepasster vorläufiger Sachwert
+/- boG (besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale)
= Sachwert
NHK, oder Normalherstellungskosten, sind ein wesentlicher Bestandteil bei der Wertermittlung von Immobilien im Sachwertverfahren. Sie repräsentieren die durchschnittlichen Kosten, die erforderlich wären, um ein Gebäude oder sonstigen Anlagen unter normalen wirtschaftlichen Bedingungen in gleicher Art und Güte neu zu errichten.
Die Herstellungskosten ergeben sich aus folgender Formel:
NHK x Gebäudefläche (z.B. Wohnfläche oder Bruttogrundfläche) = Herstellungskosten (HK)
Um den Gebäudewert des Bewertungsobjekts zu ermitteln, muss das Alter der Immobilie berücksichtigt werden. Dies geschieht durch die sog. Alterswertminderung.
Das Wertermittlungsobjekt ist auf der Grundlage seiner Standardmerkmale zu qualifizieren. Die Sachwertrichtlinie (Anlage 2) führtentsprechende Orientierungstabellen auf. Der Standard eines Gebäudes kann durch die Tabelle zwischen den Größen 1 - 5 bestimmtwerden.
Bei der Sachwertermittlung müssen zusätzlich besondere Bauteile erkannt und wertmäßig bestimmt werden.
Häufig vorkommende besondere Bauteile sind:
- Kelleraußentreppen
- Eingangsüberdachungen
- Balkone
Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), welche als „Kosten für Planung, Baudurchführung,behördliche Prüfung und Genehmigungen“ definiert sind. Die Baunebenkosten sind üblicherweise in den durchschnittlichenHerstellungskosten bereits enthalten.
Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhältnis der durchschnittlichen örtlichen zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch ihn sollen die durchschnittlichen Herstellungskosten an das örtliche Baukostenniveauangepasst werden. Gemäß § 36 Abs. 3 ImmoWertV 21 ist der Regionalfaktor ein bei der Ermittlung des Sachwertfaktors festgelegter Modellparameter.
Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird in der Regel nach dem linearen Abschreibungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes und der jeweils modellhaft anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GND)vergleichbarer Gebäude ermitttelt.
Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen (insbesondere Ver- undEntsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, Einfriedungen, Wegebefestigungen) und nicht baulicheAnlagen (insbesondere Gartenanlagen).x
Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis, der sogenannte „vorläufige Sachwert“, entspricht in der Regel nicht den tatsächlich gezahlten Marktpreisen. Daher muss dieses Ergebnis, also der Substanzwert des Grundstücks, an den Markt angepasst werden, indem es den für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreisen angeglichen wird. Dies geschieht mithilfe des sogenannten objektspezifischangepassten Sachwertfaktors. Der Sachwertfaktor stellt das durchschnittliche Verhältnis zwischen den Kaufpreisen und den nach den Vorschriften der ImmoWertV 21 ermittelten „vorläufigen Sachwerten“ (Substanzwerte) dar. Er wird hauptsächlich nach Objektart, Region und Objektgröße differenziert. Durch die korrekte Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten Sachwertfaktors wird das Sachwertverfahren zu einem echten Vergleichspreisverfahren.
boG | besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale
Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale umfassen alle individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts,die vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichen. Dazu gehören beispielsweise Abweichungen vom normalen baulichenZustand, wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden, grundstücksbezogene Rechte und Belastungensowie Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen. Darüber hinaus gibt es noch weitere boG´s die individuell erkanntund wertmäßig berücksichtigt werden müssen.
Häufig stellt der Sachverständige bei der Ortsbesichtigung fest, dass der potenzielle Erwerber einige Schäden beseitigen muss.Wenn es sich dabei um reine Instandsetzungsmaßnahmen handelt, bei denen der Erwerber kaum Gestaltungsspielraum hat,entspricht der Werteinfluss dieser Bauschäden in der Regel den durchschnittlichen Kosten der Schadensbeseitigung.
Bei umfangreichen Instandsetzungsmaßnahmen wird oft die Möglichkeit genutzt, um zugleich eine Modernisierung durchzuführen. So erhöht sich der Gestaltungsspielraum.
Wichtig bei der Beurteilung der Werte ist die Anpassung der Kosten an den Markt. Grundsätzlich gilt:
- Instandsetzungskosten werden mit dem Anpassungsfaktor 1 berücksichtigt.
-Modernisierungskosten können (da in der Regel werterhöhend) mit dem objektspezifischen Sachwertfaktor bewertet werden.
Eine besonders ausgefallene Architektur kann positive wie auch negative Einflüsse haben.
Wertermittlungen von Immobilien werden in der Regel mit den marktüblich erzielbaren Mieten berechnet (also nachhaltig kalkuliert). Bestehende Mehr- oder Mindermieten müssen dann wertmäßig berücksichtigt werden. Aus Gründen der Modellkonformität, erfolgt dies regelmäßig nach dem vorläufigen Verfahrenswert. Wichtig ist, dass die Abweichungen rechtlich zuläßig sind.
Ein Sonderfall der Mindermiete ist der Leerstand. Der geschätzte Mietausfall muss über die Zeitspanne bis zur Wiedervermietung in Abzug gebracht werden. Laufende Kosten (Bewirtschaftungskosten) erhöhen den Ausfall.
Grunddienstbarkeiten sind privatrechtliche Verpflichtungen, die ein Grundstück betreffen und in der Regel zwischen zwei oder mehrerenGrundstücken bestehen. Sie regeln das Nutzungsrecht oder die Unterlassung bestimmter Handlungen zugunsten eines anderenGrundstücks.
Typische Beispiele sind:
Wegerecht: Das Recht, ein fremdes Grundstück zu durchqueren, um zu einem eigenen Grundstück zu gelangen.
Leitungsrecht: Das Recht, Leitungen (z.B. Wasserleitungen, Stromkabel) über das Grundstück eines anderen zu führen.
Nießbrauch: Das Recht, ein Grundstück oder Gebäude zu nutzen und daraus Erträge zu ziehen.
Baulasten hingegen sind öffentlich-rechtliche Verpflichtungen, die sich auf ein Grundstück beziehen und meist durch Baurecht oderBauordnungen der Gemeinden festgelegt werden. Sie sind Voraussetzung für die Erteilung einer Baugenehmigung und regeln spezifische Anforderungen oder Verpflichtungen im Zusammenhang mit einem Bauvorhaben.
Typische Beispiele sind:
Abstandsflächen: Festlegung eines Mindestabstands zu den Grundstücksgrenzen für Gebäude.
Stellplatzbaulast: Der erforderliche Stellplatz wird auf einem anderen Grundstück realisiert
Erschließungsbaulast: Ein Teil der Erschließung erfolgt über ein anderes Grundstück.
Das Wohnungsrecht ist ein im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregeltes dingliches Recht, das einer Person das Recht einräumt, eine bestimmte Immobilie zu nutzen, ohne dass sie Eigentümer der Immobilie ist. Es wird in den §§ 1093 ff. BGB beschrieben.
Das Wohnungsrecht ist grundsätzlich nicht übertragbar und nicht veräußerlich. Es kann also nicht verkauft, vermietet oder anderweitig an Dritte weitergegeben werden (§ 1092 BGB).
Im Kontext der Immobilienbewertung muss das Recht wertmäßig beziffert und vom vorläufigen Verfahrenswert in Abzug gebracht werden.
Das Nießbrauchrecht gemäß BGB ist ein weitreichendes Nutzungsrecht, das dem Nießbraucher erlaubt, die Erträge einer Sache zu ziehen (also z.B. vermieten), ohne deren Eigentümer zu sein. Es sichert dem Nießbraucher eine umfassende Nutzungsmöglichkeit, während derEigentümer weiterhin die Substanz der Sache besitzt. Das Nießbrauchrecht ist grundsätzlich nicht übertragbar und nicht veräußerlich.Im Kontext der Immobilienbewertung muss das Recht wertmäßig beziffert und vom vorläufigen Verfahrenswert in Abzug gebracht werden.
Immobilienwissen | Rechtliches.
Das deutsche Grundbuch ist ein öffentliches Verzeichnis, das alle Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte in einem bestimmten Gerichtsbezirk erfasst. Es dient der Dokumentation und Sicherung von Eigentumsverhältnissen sowie anderen dinglichen Rechten an Grundstücken. Geführt wird das Grundbuch in Deutschland nach den Bestimmungen des Grundbuchrechts und ist beim zuständigen Amtsgericht hinterlegt.
Nutzen des Grundbuchs:
Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, dessen Hauptziel es ist, Klarheit über die dinglichen Rechtsverhältnisse anGrundstücken zu schaffen. Aufgrund der großen wirtschaftlichen Bedeutung des Eigentums an Grundstücken und der damit verbundenen Rechte ist diese Transparenz unerlässlich.
Das Grundbuch dokumentiert dabei:
Eigentumsverhältnisse: Es zeigt, wer die Eigentümer der Grundstücke sind.
Dingliche Belastungen: Es macht alle bestehenden Belastungen sichtbar.
Rangverhältnisse: Es legt die Rangfolge der Belastungen fest und zeigt auf, welche Belastungen Vorrang haben.
Zusätzlich informiert das Grundbuch über mögliche Verfügungsbeschränkungen oder -verbote. Miet- und Pachtverhältnisse werden im Grundbuch jedoch nicht erfasst.
Das Grundbuch dient der Klarheit und Transparenz über die Rechtsverhältnisse an Grundstücken, um den Rechtsverkehr auf dieRichtigkeit der Eintragungen zu verlassen. Nach § 891 BGB besteht eine gesetzliche Vermutung, dass ein im Grundbucheingetragenes Recht tatsächlich besteht und dem Eingetragenen zusteht (positive Vermutung). Ein im Grundbuch gelöschtes Rechtgilt ab der Löschung als nicht mehr existent (negative Vermutung). Die gesetzliche Vermutung kann jedoch durch den vollen Beweisder Unrichtigkeit widerlegt werden, woraufhin das Grundbuch berichtigt werden muss. Im Hinblick auf die Immobilienverrentung undLiquidität werden die Vereinbarungen im Notarvertrag geregelt und in der Grundakte hinterlegt. Es besteht somit höchstmöglicheBeweissicherheit für den Begünstigten.
Nach § 892 BGB schützt der öffentliche Glaube des Grundbuchs den Käufer eines Rechts oder Grundstücks. Der Käufer darf auf dieRichtigkeit der Eintragungen vertrauen. Dieser Schutz gilt nicht, wenn ein Widerspruch gegen die Richtigkeit im Grundbucheingetragen ist oder der Käufer positive Kenntnis von der Unrichtigkeit hat. Zweifel oder grob fahrlässige Unkenntnis genügen nicht.
Die Grundbücher werden von den sogenannten Grundbuchämtern verwaltet. Der Begriff „Amt“ kann irreführend sein, da dieseÄmter Abteilungen der Amtsgerichte und nicht der allgemeinen Verwaltung sind. Die Grundbuchämter sind zuständig für dieGrundstücke, die sich in ihrem jeweiligen Bezirk befinden.
Für jedes Grundbuchblatt wird eine separate Grundakte geführt. In dieser Akte werden alle Urkunden aufbewahrt, die für dieEintragungen im Grundbuch relevant sind. Dazu zählen insbesondere Kaufverträge, bei Wohnungseigentum auch dieTeilungserklärungen, sowie bei Erbschaften Erbscheine oder Testamente. Diese Dokumente bilden die Grundlage für dieEintragungen im Grundbuch und ermöglichen es, den genauen Inhalt und Umfang der Rechte nachzuvollziehen. Zusätzlich werden in den Grundakten alle schriftlichen Eingaben, Verfügungen des Grundbuchamtes und Kostenberechnungen dokumentiert.
Aufbau des GrundbuchsDas deutsche Grundbuch besteht aus fünf Teilen, die im Folgenden näher beschrieben werden:
Aufschrift:
In der Aufschrift sind das zuständige Amtsgericht, der Grundbuchbezirk sowie die Nummer des Bandes (falls noch vorhanden) und des Blattes angegeben. Zudem enthält die Aufschrift Vermerke über die Umschreibung eines Blattes sowie etwaige Schließungsvermerke. Außerdem wird vermerkt, ob das Grundbuchblatt für Wohnungseigentum, Teileigentum oder ein Erbbaurecht angelegt ist.
Bestandsverzeichnis:
Das Bestandsverzeichnis dokumentiert den Grundstücksbestand und etwaige Änderungen.
Es enthält:
Laufende Nummer: Die Nummer des Grundstücks.
Herkunft: Bei neu entstandenen Grundstücken werden die ursprünglichen Nummern angegeben.
Bezeichnung: Details wie Gemarkung, Flur- und Flurstücksnummer, Lage und Nutzung des Grundstücks.
Größe: Die Fläche des Grundstücks.
Bestand und Veränderungen: Auflistung von Grundstücken bei der Anlegung des Grundbuchs sowie spätere Änderungen.
Abteilung I - Eigentumsverhältnisse:
In Abteilung I des Grundbuchs sind die Eigentümer des Grundstücks oder Wohnungseigentums sowie die Inhaber von Erbbaurechten aufgeführt.
Die Eintragungen umfassen:
Natürliche Personen: Mit Vorname, Nachname, Wohnort, Geburtsdatum oder Beruf.
Einzelkaufleute: Unter ihrem persönlichen Namen, nicht unter der Firma.
Juristische Personen oder Handelsgesellschaften: Mit Namen oder Firma und Sitz.
Wenn mehrere Personen ein Recht gemeinschaftlich besitzen, werden alle Personen und das Gemeinschaftsverhältnis angegeben. Dies gilt auch für die Abteilungen II und III. Zum Beispiel werden Miteigentümer mit Namen und ihren Anteilen eingetragen, während Gesellschafter einer BGB-Gesellschaft mit dem Zusatz „als Gesellschafter bürgerlichen Rechts“ aufgeführt werden.Erbengemeinschaften werden mit den Namen aller Miterben und dem Zusatz „in Erbengemeinschaft“ eingetragen, jedoch ohne dieErbanteile. Diese Informationen sind in den Grundakten zu finden.Zusätzlich wird die Grundlage der Eintragung, wie Auflassung oder Erbfolge, sowie das Datum der Eintragung vermerkt.
Abteilung II - Lasten und Beschränkungen:
In Abteilung II des Grundbuchs werden alle Belastungen eines Grundstücks oder eines Anteils am Grundstück eingetragen, mitAusnahme von Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden und den damit verbundenen Vormerkungen und Widersprüchen. Dazugehören insbesondere Grunddienstbarkeiten, persönliche Dienstbarkeiten, Erbbaurechte, Nießbrauchrechte, Vorkaufsrechte und Reallasten.
Zusätzlich werden in dieser Abteilung die Beschränkungen des Verfügungsrechts des Eigentümers sowie Vormerkungen undWidersprüche vermerkt. Wichtige Eintragungen umfassen Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsvermerke, Insolvenzvermerke, allgemeine Veräußerungsverbote, Testamentsvollstreckervermerke sowie Umlegungs- und Sanierungsvermerke nach den entsprechenden Baugesetzbuch-Vorschriften.
Abteilung III - Grundpfandrechte:
In der dritten Abteilung des Grundbuchs werden Hypotheken, Grundschulden und Rentenschulden sowie die entsprechendenVormerkungen und Widersprüche eingetragen. Diese Abteilung dokumentiert den Betrag und die Art der Belastungen.
Zusätzlich werden alle Änderungen und Löschungen von Belastungen vermerkt. Gelöschte Eintragungen werden zusätzlich zu den Löschungsvermerken in der entsprechenden Abteilung rot unterstrichen.
Das Rangverhältnis der Rechte in den Abteilungen II und III des Grundbuchs bestimmt ihre relative Bedeutung, insbesondere beiZwangsversteigerungen oder Zwangsverwaltungen. Der Rang eines Rechts wird durch die Reihenfolge der Eintragung der Anträge beim Grundbuchamt festgelegt. Rechte, die später eingetragen werden, haben einen niedrigeren Rang als solche, die früher eingetragen wurden. Im Kontext der Immobilienverrentung und Liquidität kann bei der Veräußerung die Rangstelle des Rechts (Wohnungsrecht oder Nießbrauchrecht) festgelegt werden. Die höchstmögliche Sicherheit bietet die erstrangige (ggf. auch vorrangige) Grundbucheintragung des jeweiligen Rechts.
Der öffentliche Glaube an die Richtigkeit des Grundbuchs umfasst auch das Rangverhältnis, sodass ein Erwerber das Recht mit dem zum Erwerbszeitpunkt eingetragenen Rang erhält.
Die Grundschuld ist ein dingliches Recht, das zur Absicherung von Forderungen dient. Sie wird ins Grundbuch eingetragen und gewährt dem Gläubiger das Recht, aus einem bestimmten Grundstück eine bestimmte Geldsumme zu verlangen. Die Grundschuld ist dabei unabhängig von einer konkreten Forderung und kann für verschiedene Arten von Krediten oder Darlehen verwendet werden.
Der Notar spielt eine unverzichtbare Rolle bei Immobiliengeschäften, indem er die Rechtsicherheit gewährleistet, die Einhaltung gesetzlicher Formvorschriften überwacht und die Eigentumsübertragung im Grundbuch sicherstellt. Seine Tätigkeit trägt dazu bei,Streitigkeiten zu vermeiden und den rechtlichen Rahmen für den Kauf oder Verkauf einer Immobilie transparent und nachvollziehbar zu gestalten. Für rechtliche Beratung hingegen müssen sich die Parteien an spezialisierte Rechtsanwälte oder Fachexperten wenden.
Der Kaufvertrag ist ein unverzichtbares Dokument im Immobiliengeschäft, das die rechtliche Grundlage für den Eigentumsübergangan einer Immobilie bildet. Er bietet Schutz, Klarheit und Sicherheit für beide Parteien und dient als verbindliche Vereinbarung überden Kauf und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden.
Folgende Funktionen hat er:
- Verbindliche Vereinbarung
- Rechtliche Grundlage
- Beweiskraft
- Grundlage für rechtliche Sicherheit
- Vertragliche Verpflichtungen
- Schutz der Parteien
- Rechtssicherer Eigentumsübergang
Baulasten sind öffentlich-rechtliche Verpflichtungen, die sich auf ein Grundstück beziehen und meist durch Baurecht oderBauordnungen der Gemeinden festgelegt werden. Sie sind Voraussetzung für die Erteilung einer Baugenehmigung und regelnspezifische Anforderungen oder Verpflichtungen im Zusammenhang mit einem Bauvorhaben.
Typische Beispiele sind:
Abstandsflächen: Festlegung eines Mindestabstands zu den Grundstücksgrenzen für Gebäude. Stellplatzbaulast: Der erforderliche Stellplatz wird auf einem anderen Grundstück realisiert Erschließungsbaulast: Ein Teil der Erschließung erfolgt über ein anderes Grundstück
Während öffentliche Reallasten durch öffentlich-rechtliche Vorgaben entstehen und im Interesse der Allgemeinheit liegen, kommenprivate Reallasten durch vertragliche Vereinbarungen zwischen privaten Parteien zustande und dienen privaten Interessen oderNutzungen. Beide Arten von Reallasten haben spezifische rechtliche Rahmenbedingungen und Folgen.
Das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) regelt in Deutschland die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Wohnungseigentum und die Verwaltung von Wohnungseigentumsanlagen. Das Wohnungseigentumsgesetz schafft einen rechtlichen Rahmen für das Zusammenleben und die Verwaltung von Wohnungseigentümern in einer Gemeinschaft. Es stellt sicher, dass Interessenkonflikte geregelt und der gemeinschaftlicheZusammenhalt gefördert werden. Die genauen Bestimmungen des WEG sind wichtig für alle Wohnungseigentümer und Verwalter, um rechtlich korrekt und transparent zu handeln und Streitigkeiten zu vermeiden oder zu lösen.
Gemäß § 903 BGB ist Eigentum das umfassendste Recht an einer Sache. Der Eigentümer einer Sache hat das Recht, mit der Sachenach Belieben zu verfahren, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen.
Wohnungseigentum
Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil am gemeinschaftlichenEigentum der Wohnanlage, zu dem es gehört.
Teileigentum bezeichnet das Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen oder Gebäudeteilen innerhalb einerWohnanlage. Dabei handelt es sich um Räumlichkeiten, die nicht als eigenständige Wohnungen genutzt werden, sondernbeispielsweise für gewerbliche, technische oder andere Zwecke dienen können. Ein typisches Beispiel für Teileigentum ist eine Gewerbeeinheit, eine Tiefgarage oder ein Lagerraum innerhalb eines Mehrfamilienhauses.
Gemeinschaftseigentum umfasst diejenigen Teile eines Grundstücks oder Gebäudes, die nicht im Sondereigentum eines einzelnenWohnungseigentümers stehen, sondern von der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) gemeinschaftlich genutzt werden. Typische Beispiele für Gemeinschaftseigentum sind das Grundstück selbst, das Fundament, das Dach, die Fassaden, das Treppenhaus, Aufzüge, aber auch Grünanlagen, Spielplätze und andere gemeinschaftliche Einrichtungen.
Sondereigentum ist das (alleinige) Eigentum an einer bestimmten Wohnung oder einem bestimmten Gebäudeteil innerhalb einerWohnungseigentümergemeinschaft, das dem jeweiligen Wohnungseigentümer exklusiv zur Nutzung und Verfügung steht.
Sondernutzungsrecht bezeichnet das Recht eines Wohnungseigentümers, bestimmte Teile des Gemeinschaftseigentums allein undausschließlich zu nutzen, obwohl diese eigentlich zum Gemeinschaftseigentum gehören. Ein häufiges Beispiel ist ein Gartenanteil.
Der Mietspiegel ist eine öffentlich zugängliche Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete für verschiedene Arten vonWohnungen in einer bestimmten Stadt oder Region. Er wird regelmäßig von den Kommunen erstellt oder anerkannt und dient alsOrientierungshilfe für die Festsetzung von Mietpreisen.
Es gibt zwei Arten von Mietspiegeln:
Einfacher Mietspiegel
Qualifizierter Mietspiegel
Flächen | Wohnfläche.
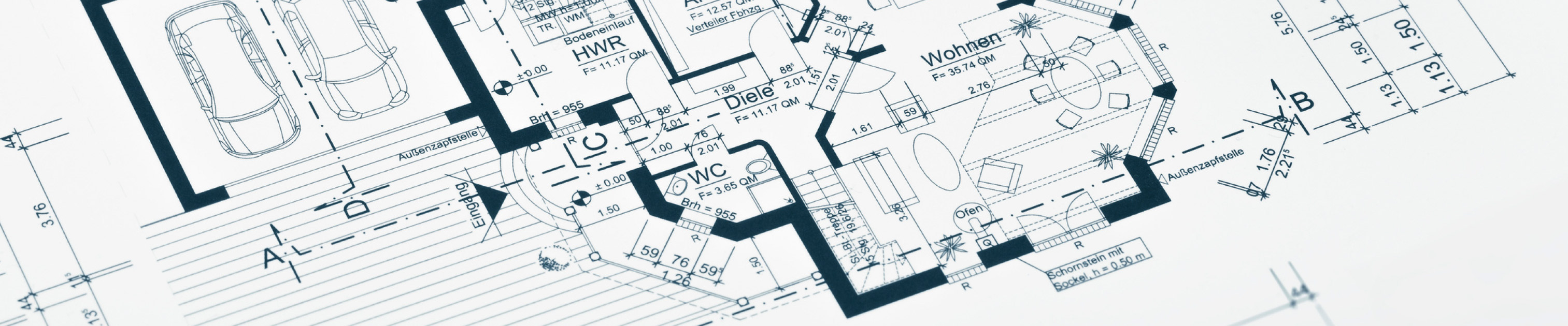
Die Wohnfläche ist eine der wichtigsten Kennzahlen im Immobilienbereich. Sie dient nicht nur als Grundlage für viele rechtliche, finanzielle und wirtschaftliche Entscheidungen, sondern beeinflusst auch den Wert und die Nutzung von Immobilien.
Hier sind die zentralen Anwendungsbereiche der Wohnfläche:
1. Berechnungsgrundlage für Mieterhöhungen
Die Wohnfläche ist ein entscheidender Faktor bei der Berechnung von Mieterhöhungen. Eine korrekte Flächenangabe ist dabei essenziell, um Streitigkeiten zwischenVermietern und Mietern zu vermeiden.
2. Verteilung der Nebenkosten und MiteigentumsanteileIn
Mehrfamilienhäusern oder größeren Wohnanlagen spielt die Wohnfläche eine wichtige Rolle bei der Aufschlüsselung der Mietnebenkosten. Sie dient als Basis fürdie faire Verteilung von Kosten wie Heiz- und Betriebskosten. Zudem ist sie für die Berechnung der Miteigentumsanteile nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)relevant.
3. Bedeutung für Baufinanzierungen
Bei Baufinanzierungen ist die Wohnfläche oft ein entscheidender Faktor. Sie hilft dabei, die Wirtschaftlichkeit eines Bauvorhabens zu beurteilen und beeinflusst dieFinanzierungskonditionen.
4. Grundlage für die Wertermittlung
Für die Wertermittlung von Gebäuden ist die exakte Wohnfläche ein unverzichtbarer Parameter. Sie bildet häufig die Basis für die Berechnung des Vergleichs- oderErtragswerts einer Immobilie und hat direkten Einfluss auf den Marktwert. Auch beim Sachwertverfahren dient die Wohnfläche als wichtiger Indikator bei der Plausibilisierung der Sachwertberechnungen, welche in der Regel auf Basis der Bruttogrundfläche erfolgen.
5. Relevanz bei der Wohnraumförderung
Im Rahmen der Wohnraumförderung ist die Wohnfläche entscheidend für die Berechnung der Fördersumme. Je nach Programm wird die Förderung anhand derGröße der Wohnung gestaffelt.
6. Einheitsbewertung im Steuerrecht
Im Steuerrecht wird die Wohnfläche bei Einheitsbewertungen berücksichtigt, insbesondere im Hinblick auf die Festsetzung der Grundsteuer.
7. Bedeutung im Sozialrecht
Im Sozialrecht wird die Wohnfläche zur Feststellung der zumutbaren Wohnungsgröße herangezogen, beispielsweise bei der Berechnung von Mietzuschüssen oder der Angemessenheit von Wohnraum bei Sozialleistungen.
Die Flächenberechnung für Immobilien orientiert sich in Deutschland an zwei zentralen Regelwerken:
- DIN 277
- Wohnflächenverordnung (WoFlV)
Beide Regelwerke stimmen in vielen Punkten überein, unterscheiden sich jedoch in bestimmten Details, insbesondere bei der Bewertung von Flächen wie:
-Balkonen, Freisitze und Terrassen:
Diese werden gemäß DIN 277 vollständig als Nutzfläche berücksichtigt, während sie nach der WoFlV zu 25 % (bzw. 50%) der Grundfläche zur Wohnfläche zählen.
- Kellerräumen und Dachschrägen
Auch hier gibt es Abweichungen in der Berechnungsweise zwischen den beiden Regelwerken.
Daher ist es entscheidend, vor der Bewertung zu prüfen, ob die Flächenangabe auf der DIN 277 oder der WoFlV basiert.
Verbindliche Angabe der Berechnungsgrundlage
In allen Objektunterlagen sollten die Berechnungsgrundlagen der angegebenen Flächen klar und eindeutig angegeben werden.Dies schafft Transparenz und verhindert Missverständnisse zwischen den Parteien.
Im Immobilienbereich begegnet man häufig Begriffen wie Wohnfläche, Nutzfläche oder Wohnraum. Doch trotz ihrer Bedeutung gibt es bis heute keine einheitlich verbindliche gesetzliche Regelung oder Begriffsbestimmung für diese Flächenangaben.
Rechtsunsicherheiten bei der Definition von Wohnfläche und Wohnraum
Die fehlende klare Definition führt in der Praxis zu erheblichen Herausforderungen:
Unterschiedliche Rechtsgebiete verwenden teils voneinander abweichende Vorschriften, was die Anwendung erschwert oder gar unmöglich macht.
Die Rechtsprechung legt diese Begriffe oft unterschiedlich aus, abhängig vom jeweiligen Sachverhalt oder Anwendungsgebiet.
Einheitliche Verfahrensweisen sind aufgrund dieser Uneinheitlichkeit kaum durchführbar.
Was bedeutet Wohnfläche ?
Der Begriff „Wohnfläche“ ist gesetzlich nicht eindeutig definiert. Um eine Wohnfläche rechtssicher zu berechnen, ist ein Bezug zu einer Verordnung oder Norm notwendig, beispielsweise zur Wohnflächenverordnung (WoFlV). Erst durch die Anwendung solcher Regelwerke wird eine korrekte und nachvollziehbare Wohnflächenberechnung möglich. Diese Verordnungen regeln unter anderem, welche Flächen in die Berechnung einbezogen werden (z. B. Balkone, Dachschrägen)
und wie diese bewertet werden.
Rechtssichere Wohnflächenberechnung - Warum sie wichtig ist:
Eine präzise und normgerechte Wohnflächenberechnung schafft Transparenz und Rechtssicherheit, insbesondere bei Mietverträgen:
Die Wohnfläche beeinflusst die Miethöhe und Nebenkostenverteilung.
Immobilienbewertung:
Die exakte Wohnfläche ist eine Grundlage für die Wertermittlung.
Finanzierungen:
Banken orientieren sich bei der Finanzierung oft an der angegebenen Wohnfläche.
Förderprogrammen:
Wohnflächenangaben sind entscheidend für die Höhe von Wohnraumförderungen.
Die Berechnung der Wohnfläche ist ein entscheidender Punkt bei Kauf- oder Mietverträgen. Doch wer legt eigentlich die Berechnungsvorschrift fest?
Bestimmungsrecht bei der Wohnflächenberechnung:
Aktuell bleibt es den Vertragsparteien – also Käufer und Verkäufer oder Mieter und Vermieter – überlassen, die Berechnungsgrundlage für die Wohnflächefestzulegen. In der Regel liegt das Bestimmungsrecht jedoch beim Verkäufer oder Vermieter.
Was passiert, wenn keine Berechnungsvorschrift genannt wird?
Die Berechnung der Wohnfläche ist ein zentrales Element in Miet- und Kaufverträgen.Doch was passiert, wenn keine klare Berechnungsvorschrift im Vertrag angegeben wird?
Standardannahme: Berechnung nach WoFlV
Seit 2004 wird in der Regel angenommen, dass die Wohnfläche nach den Vorgaben der Wohnflächenverordnung (WoFlV) ermittelt wird.Diese Norm bietet eine Standardisierung, ist jedoch nicht gesetzlich verpflichtend. Das bedeutet, dass auch andere Berechnungsgrundlagen,wie die DIN 277, herangezogen werden könnten, wenn keine Vereinbarung vorliegt.
Problem: Fehlen einer klaren Berechnungsgrundlage
Das Fehlen einer eindeutig vereinbarten Berechnungsvorschrift birgt erhebliche Risiken.Unklare AngabenOftmals werden Wohnflächen in Verträgen angegeben, jedoch ohne Verweis auf die zugrunde liegende Berechnungsmethode. Das kann zu Missverständnissen führen.
Streitigkeiten zwischen den Parteien
Käufer, Mieter oder Vermieter könnten unterschiedliche Normen heranziehen, was zu Abweichungen in der Wohnflächenberechnung führt.
Rechtliche Auseinandersetzungen
Uneinigkeit über die richtige Berechnungsgrundlage kann in gerichtlichen Streitfällen münden, insbesondere wenn finanzielle oder rechtliche Verpflichtungen wie Kaufpreis, Miete oder Nebenkosten betroffen sind.
Rückabwicklung von Verträgen
Wenn sich nachträglich herausstellt, dass die ausgewiesene Wohnfläche erheblich von der tatsächlich berechneten Fläche abweicht, kann dies zur Anpassung des Kaufpreises, Mietminderungen oder sogar zur Rückabwicklung des Vertrags führen.
Warum ist eine klare Vereinbarung essenziell?
Die Wahl der Berechnungsgrundlage, beispielsweise WoFlV oder DIN 277, kann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, insbesondere bei: Einbeziehung von Balkonen, Terrassen oder Dachschrägen. Bewertung von Kellerräumen und Abstellflächen.
Ohne klare Angabe der Berechnungsgrundlage haben beide Parteien Interpretationsspielraum, was Unsicherheiten schafft und das Risiko von Konflikten erhöht.
Berechnung der Wohnfläche nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV)
Die Berechnung der Wohnfläche nach Vorgaben der Wohnflächenverordnung (WoFlV) richtet sich nach den §§ 2 bis 4 WoFlV.Dabei werden die Grundflächen der Räume ermittelt und auf die Wohnfläche angerechnet.
1. Was gehört zur Wohnfläche?
Zur Wohnfläche zählen die Grundflächen der Räume, die ausschließlich einer Wohnung zugeordnet sind.Dies sind Wohn- und Schlafzimmer, Küchen, Badezimmer, Flure
2. Gemeinschaftlich genutzte Räume
In Wohnheimen umfasst die Wohnfläche auch die Grundflächen der Räume, die zur gemeinschaftlichen Nutzung durch die Bewohner vorgesehen sind.
3. Wintergärten, Schwimmbäder und ähnliche Räume
Nach § 2 WoFlV werden auch die Grundflächen von Wintergärten, Schwimmbädern und anderen nach allen Seiten geschlossenen Räumen zur Wohnflächehinzugerechnet.
Nicht alle Räume einer Immobilie werden in die Wohnfläche einbezogen. Die Wohnflächenverordnung (WoFlV) und das Bauordnungsrecht der Länder legen fest,welche Flächen ausgeschlossen sind.
1. Zubehörräume
Folgende Räume zählen nicht zur Wohnfläche, da sie unterstützende oder technische Funktionen erfüllen:
- Kellerräume
- Abstellräume und Kellerersatzräume außerhalb der Wohnung
- Waschküchen
- Bodenräume
- Trockenräume
- Heizungsräume
- Garagen
2. Räume, die baurechtliche Anforderungen nicht erfüllen
Räume, die den Anforderungen des Bauordnungsrechts der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) nicht genügen, werden ebenfalls nicht als Wohnflächeangerechnet.
Beispiele:
- Zu niedrige Deckenhöhen
- Unzureichende Belichtung oder Belüftung
3. Geschäftsräume
Flächen, die ausschließlich für gewerbliche Zwecke genutzt werden, wie Büros, Verkaufsflächen oder Werkstätten
Die Berechnung der Grundfläche erfolgt nach klar definierten Regeln, um eine präzise und rechtssichere Grundlage zu schaffen. Dies betrifft sowohl die Flächen,die einbezogen werden müssen, als auch solche, die unberücksichtigt bleiben. Zudem gelten spezielle Vorgaben für die Messung im fertiggestellten Raumoder die Ermittlung anhand von Bauzeichnungen.
Grundsätze der Grundflächenermittlung
Die Grundfläche wird nach den lichten Maßen zwischen den Bauteilen berechnet. Maßgeblich sind hierbei die Vorderkanten der Bekleidungen der Bauteile.
Fehlende begrenzende Bauteile
Hier ist der bauliche Abschluss maßgebend, z. B. ein Balkongeländer oder das Ende einer Terrasse.Begrenzende BauteileHierzu zählen beispielsweise die Vorderseite einer Wand.
Einzubeziehende Flächen
Folgende Grundflächen werden bei der Berechnung berücksichtigt:
- Tür- und Fensterbekleidungen sowie Tür- und Fensterumrahmungen
- Fuß-, Sockel- und Schrammleisten
Fest eingebaute Gegenstände, wie:
- Öfen
- Heiz- und Klimageräte, HerdeBade- oder Duschwanne
- Freiliegende Installationen z. B. Rohre und Leitungen
- Einbaumöbel
- Nicht ortsgebundene, versetzbare Raumteiler
Nicht einzubeziehende Flächen
Die folgenden Bereiche bleiben unberücksichtigt:
- Schornsteine, Vormauerungen, Bekleidungen, freistehende Pfeiler und Säulen,sofern ihre Höhe mehr als 1,50 m beträgt und Ihre Grundfläche mehr als 0,1 m² umfasst.
- Treppen mit mehr als drei Steigungen sowie deren Treppenabsätze.
- Türnischen.
- Fenster- und offene Wandnischen die Nicht bis zum Fußboden reichen oder bis zum Fußboden reichen, jedoch weniger als 0,13 m tief sind.
Methoden zur Grundflächenermittlung
- Messung im fertig gestellten Wohnraum:
Die Grundfläche wird direkt durch Ausmessung der lichten Maße ermittelt.
- Ermittlung auf Grundlage einer Bauzeichnung:
Die Bauzeichnung muss für ein bauordnungsrechtliches Verfahren erstellt oder dafür geeignet sein. Sie muss die Ermittlung der lichten Maße gemäß den oben genannten Vorgaben ermöglichen
Abweichungen zwischen Bauzeichnung und Bauausführung
Wenn die Bauausführung von der ursprünglichen Bauzeichnung abweicht, ist die Grundfläche neu zu berechnen, entweder durch Messung im fertiggestelltenWohnraum oder anhand einer aktualisierten Bauzeichnung.
Anrechnung der Grundflächen
Nicht alle Flächen werden vollständig zur Wohnfläche hinzugerechnet. Die Anrechnung erfolgt nach spezifischen Vorgaben.Terrassen, Balkone und Loggien
Diese werden in der Regel mit 25 % ihrer Grundfläche angerechnet, können jedoch unter bestimmten Bedingungen auch bis zu 50 % angerechnet werden.DachschrägenFlächen unter Dachschrägen werden nur teilweise angerechnet:0 % bei einer lichten Höhe unter 1 Meter50 % bei einer lichten Höhe zwischen 1 und 2 Metern100 % bei einer lichten Höhe über 2 Metern
Fazit: Flächenangaben – Präzision schafft Sicherheit
Ob bei der Immobilienbewertung, der Kalkulation von Bauprojekten oder der Erstellung von Kaufverträgen – die präzise Berechnung und Angabe von Flächen nach DIN 277 oder WoFlV sorgt für Transparenz, Verlässlichkeit und rechtliche Sicherheit.Als erfahrenes Sachverständigenbüro garantieren wir, dass alle Flächenangaben sorgfältig und nach den gültigen Normen ermittelt werden.